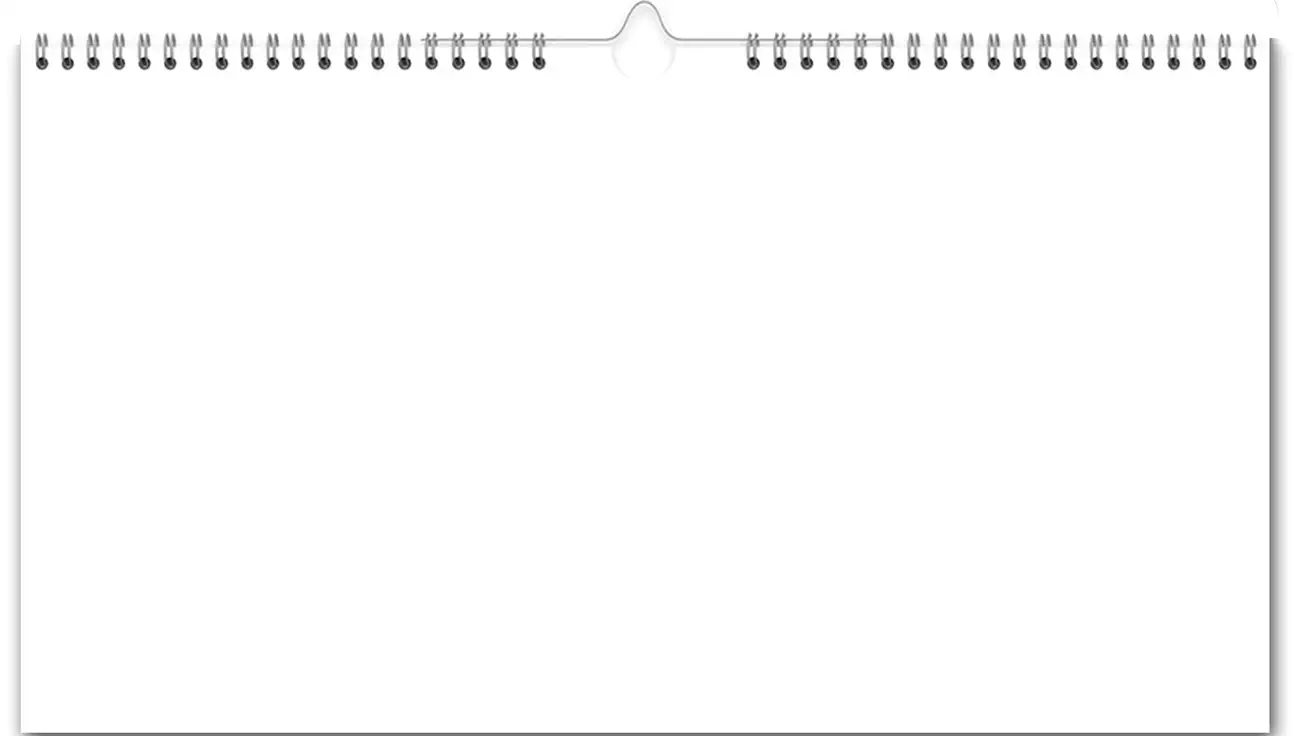Es war ein grauer Novembermorgen in Roubaix. Marie Durand, 31 Jahre alt, schob ihr Tablet beiseite und rieb sich die Augen. Auf ihrem Smartphone leuchtete eine Nachricht auf: „Marie, kommen Sie bitte kurz in mein Büro. – Valois“.
Monsieur Valois, der Chefredakteur der „La Lanterne du Nord“, war ein Mann der alten Schule. Obwohl die Redaktion mittlerweile mit modernsten Bildschirmen und digitalem Workflow ausgestattet war, bestand er darauf, wichtige Reportagen persönlich zu besprechen. Er sah seine Zeitung – ob gedruckt oder als App – noch immer als das Licht, das die Wahrheit in die dunklen Ecken der Industrieviertel brachte.
„Marie“, sagte er, während er auf seinem großen Monitor eine Karte der Atlantikküste schloss. „Unsere ‚Lanterne‘ beleuchtet hier im Norden alles. Aber draußen im Atlantik stehen die wahren Laternen. Man nennt sie die ‚Hölle der Höllen‘. Ich will, dass Sie dorthin fahren. Wir brauchen keine rein technischen Berichte – davon gibt es genug im Netz. Ich will, dass Sie über die Menschen schreiben. Nutzen Sie Ihre Kamera, fangen Sie die Seele dieser Orte ein. Bringen Sie das Licht unserer Redaktion zu den Lichtern der Bretagne.“
Marie spürte ein Kribbeln im Nacken. Sie stammte aus dem Norden, weit weg von der Gischt des Atlantiks, aber die Sehnsucht nach dem rauen Finistère hatte sie schon immer begleitet. Mit ihrem Notizbuch, ihrer digitalen Kamera und dem festen Entschluss, die Seele der Türme einzufangen, machte sie sich auf den Weg.
Ihre erste Station führte sie in die Archive von Brest. Während sie auf ihrem Smartphone die GPS-Koordinaten abglich, vertiefte sie sich vor Ort in die physischen Akten – jene Dokumente, die man nicht einfach herunterladen kann. Dort, zwischen dem Geruch von altem Pergament und digitalisierten Seekarten, stieß sie auf die Geschichte, die alles verändern sollte.
Marie hielt den Atem an, als sie die Treppen des Archivs hinunterstieg. Auf ihrem Display leuchtete das Foto auf, das fast jeder kennt – die Aufnahme des Fotografen Jean Guichard aus dem Jahr 1989. Es zeigt einen Wärter in der Tür des Turms, während eine gigantische Welle ihn zu verschlingen droht.
„Die Stute“, flüsterte Marie. Der Turm verdankt seinen Namen dem Felsen Ar Gazeg, bretonisch für „Die Stute“. Doch dieses Tier war niemals zahm. Die Legenden besagen, dass der Felsen seinen Namen erhielt, weil das Brechen der Wellen dort wie das Wiehern eines wilden Pferdes klingt.
In den Akten von 1896 las sie vom Untergang des englischen Dampfers Drummond Castle. Eine Tragödie, die 242 Menschen das Leben kostete – nur drei überlebten. Einer von ihnen, Charles-Eugène Potron, konnte das Grauen jener Nacht nie vergessen. In seinem Testament verfügte er 400.000 Francs für den Bau eines Leuchtturms auf diesem verhängnisvollen Felsen. Die Bedingung war unerbittlich: Der Turm musste innerhalb von sieben Jahren fertiggestellt sein.
Marie notierte auf ihrem Tablet: „Man baute diesen Turm auf Blut und schlechtem Gewissen. Es war ein Wettlauf gegen die Zeit und die Gezeiten. Man sieht es dem Fundament an – es ist breit und trotzig, wie die Beine eines Tieres, das sich gegen den Sturm stemmt.“ Sie erfuhr, dass die Arbeiter in den ersten Jahren oft nur wenige Stunden pro Jahr auf dem Felsen verbringen konnten, ständig unter Lebensgefahr.
Sie blickte erneut auf das Foto von Théodore Malgorn. Es war der 21. Dezember 1989. Marie stellte sich vor, wie die Wände des Turms unter den Schlägen des Fromveur, einer tückischen Meerenge, erzitterten. Malgorn hörte ein Grollen und dachte, der Hubschrauber für die Ablösung sei endlich da. Er öffnete die schwere Stahltür im Erdgeschoss, bereit für die Freiheit. Stattdessen starrte er in den Schlund des Ozeans. Eine Wand aus Wasser, 30 Meter hoch, überragte den Turm.
Der Fotograf Jean Guichard, der im Hubschrauber über ihm kreiste, sah das Unheil kommen. Er gab Zeichen, schrie lautlos gegen den Wind. Malgorn begriff im letzten Sekundenbruchteil und schlug die Tür zu. Die Erschütterung war so gewaltig, dass im Inneren des Turms alles zu Boden stürzte.
„Was denkt ein Mensch in diesem Moment?“, schrieb Marie. „Ist der Granit ein Schutz oder ein Gefängnis? La Jument ist ein Ort, an dem die Natur zeigt, dass wir nur Gäste sind.“ Seit 1991 ist der Turm automatisiert. Die „Stute“ braucht keine Reiter mehr, aber sie atmet noch immer.
„Das Licht blitzt alle 15 Sekunden dreimal hintereinander auf“, schloss Marie ihren Bericht, während sie die letzte Aufnahme auf ihre Speicherkarte sicherte. „Es ist wie das schwere, rhythmische Atmen eines erschöpften Tieres, das seit über hundert Jahren im kochenden Wasser des Fromveur steht und sich weigert, unterzugehen.“