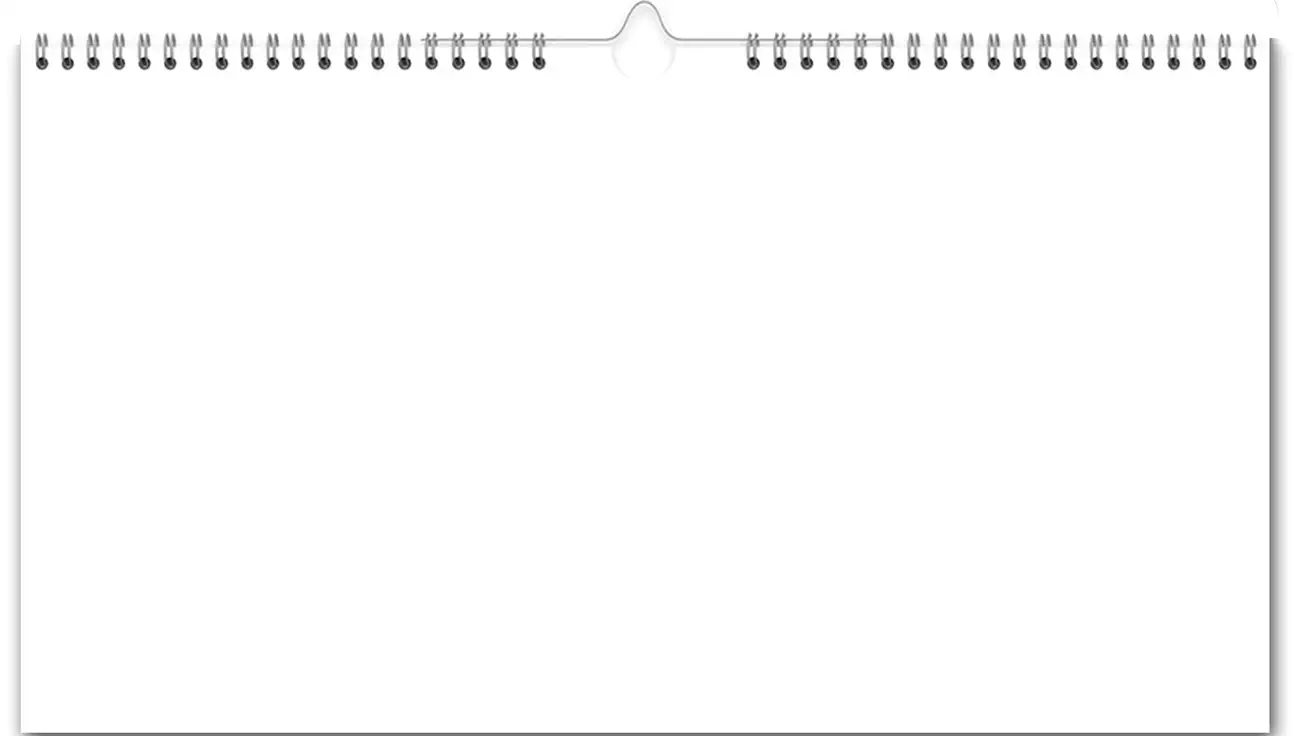Nach den intensiven Tagen in den staubigen Archiven von Brest, in denen Marie Durand mehr Zeit mit vergilbten Listen und technischen Bauplänen verbracht hatte, als ihr lieb war, hielt sie es nicht mehr in geschlossenen Räumen aus. Die Worte ihres Chefredakteurs, Monsieur Valois, hallten beständig in ihrem Hinterkopf nach: „Marie, Daten sind das Skelett einer Geschichte, aber ich will das Fleisch und das Blut. Ich will wissen, warum diese Türme noch immer stehen, obwohl die See seit Jahrhunderten an ihnen reißt.“
Mit ihrem Notizbuch, ihrem Tablet und ihrer Kamera reiste sie nach Porspoder. Ihr Ziel war ein Turm, der weniger wie ein filigranes Monument und mehr wie eine trotzige Festung aus dem Meer ragte: der Phare du Chenal du Four.
Es war ein stürmischer Februartag, als Marie am zerklüfteten Ufer stand. Der Wind war hier oben an der Nordküste des Finistère ein unerbittlicher Begleiter; er zerrte so heftig an ihrer Jacke und ihrem Journal, dass sie sich hinter einem massiven Granitfelsen ducken musste, um überhaupt eine klare Sicht zu bekommen. Vor ihr erstreckte sich der Chenal du Four, jene berüchtigte Fahrrinne zwischen dem Festland und dem Molène-Archipel. Hier prallen die Gezeitenströme des Ärmelkanals und des Atlantiks mit einer solchen Wucht aufeinander, dass das Wasser selbst bei relativer Windstille zu kochen scheint. Mittendrin, einsam und unerschütterlich, thronte der Turm, ein massiver, grauer Zylinder mit einem markanten schwarzen Band, der wie ein erhobener Zeigefinger aus der weißen Gischt ragte.
Marie notierte mit klammen Fingern:
„Er wirkt nicht wie ein Bauwerk, das Seefahrern den Weg weist. Er wirkt wie ein Krieger, der dem Atlantik den Weg versperrt. Ein 28 Meter hoher Granitblock, der seit 1874 gegen die heftigsten Strömungen Europas ankämpft. Er strahlt eine fast schon arrogante Ruhe aus, während um ihn herum die Welt in Weiß und Grau versinkt.“
Sie vertiefte sich in die Gedanken an die Bauarbeiter von damals. Der Bau des Chenal du Four, der 1869 begann, war eine einzige Qual gewesen. Der Turm steht auf einem Felsen, der bei Flut fast vollständig überspült wird. Marie hatte gelesen, dass die Männer im ersten Jahr lediglich sieben Stunden effektive Arbeitszeit auf dem Felsen verbringen konnten. Sie mussten bei extremem Niedrigwasser landen, oft bis zu den Hüften im eiskalten Wasser stehend, um mühsam Löcher für die Fundamentbolzen in den steinharten Granit zu schlagen. Wenn die Flut kam, mussten sie flüchten, bevor die Wellen sie vom Felsen rissen. Es dauerte Jahre, bis die Basis so fest im Stein verankert war, dass sie den ersten schweren Winterstürmen trotzen konnte.
Marie blickte durch ihr Teleobjektiv und versuchte, das kleine Fenster der Wachstube auszumachen. Sie dachte an die Wärter, die hier bis zur Automatisierung im Jahr 1989 ihren Dienst taten. Im Gegensatz zu den Landleuchttürmen gab es hier keine Möglichkeit für einen Spaziergang oder einen kurzen Moment im Freien. Der Lebensraum war ein runder Raum von kaum vier Metern Durchmesser.
Besonders eine Geschichte hatte sie in den Bann gezogen: Eine Sturmnacht im Winter 1914. Ein Orkan peitschte die See so hoch auf, dass die Wellen bis zur Laterne in fast 30 Metern Höhe schlugen. Die Erschütterungen waren so gewaltig, dass die schwere Kristalloptik, die tonnenschwer auf einem Quecksilberbad schwamm, aus ihrer Führung sprang. In völliger Dunkelheit, während der Turm unter den Schlägen des Meeres wie ein lebendiges Wesen erzitterte, mussten die zwei Wärter die Lampe mit bloßen Händen stützen und unter Einsatz ihres Lebens wieder in die Fassung hieven. Hätten sie versagt, wäre das Licht erloschen – und in jener Nacht hätten zahllose Schiffe im Kanal ihr Ende gefunden.
„Warum nimmt ein Mensch das auf sich?“, fragte sich Marie leise. Die Antwort fand sie in einem Brief eines ehemaligen Wärters, den sie kopiert hatte:
„Es ist die Verantwortung, Chérie. Wenn du dort oben stehst und das Licht über die Wellen wirfst, bist du der einzige Gott, den die Seeleute in dieser Nacht haben. Du darfst nicht blinzeln. Du darfst nicht müde werden. Wenn wir gehen, stirbt die Hoffnung auf dem Wasser.“
Als die Dämmerung einsetzte und das Licht des Chenal du Four zum ersten Mal an diesem Abend aufblitzte – fünf weiße Blitze in rhythmischer Folge – spürte Marie eine tiefe Ehrfurcht. Der Turm war kein kaltes Denkmal aus Stein; er war ein lebendiges Versprechen. Trotz der Februarkälte blieb sie noch lange am Ufer sitzen, bis das rhythmische Blinken das Einzige war, was die Grenze zwischen Himmel und Meer noch markierte.